Eva Andorn – Autorin
Neuigkeiten
Bei der Arbeit …


Es ist schon Ende Mai. Ich schreibe gerade keine neuen Geschichten, sondern überarbeite die Texte der letzten Monate, aus denen die Fortsetzung von „Otto“ entstehen soll. Also nicht wundern, dass es gerade nichts Aktuelles zu lesen gibt. Allen einen schönen Sommer!
Sonstiges: Am Freitag, 19. April 2024, habe ich im VITALHOTEL ambiente in Bad Wilsnack aus „Otto“ gelesen. Ein großer Dank an Martina Christ vom VITALHOTEL und ihr tolles Team und, last not least, an die zahlreichen freundlichen Gäste und unsere Nachbarn, die unterstützend mitkamen. Spitze!
Eine Ankündigung der Lesung und einen schönen Bericht zu uns und zum Buch findet Ihr hier (Prignitzer vom 16.04.2024): https://www.nordkurier.de/regional/prignitz/a-2429523
Und hier noch die Kurzinfos zum Buch: Ein Paar, Anfang fünfzig, zieht von Berlin nach Brandenburg – in ein 40-Einwohnerdorf in der Prignitz, Deutschlands am dünnsten besiedelter Region. Beide haben keine Erfahrung mit dem Landleben. Kurz vor dem Umzug kommt Leonberger-Welpe Otto dazu – von Hundeerziehung haben beide auch noch keine Ahnung.
Alles ist neu, alles muss sich einspielen. Wie sie und Hundekind Otto dies meistern und ob es die richtige Entscheidung war, aufs Land zu ziehen, davon erzählt dieses Buch, mal heiter, mal nachdenklich.
Natürlich steckt hier unsere eigene Stadtflucht drin, ja, mit Leonberger-Riesenbaby. Aber lesen Sie selbst!
… Denn mein Buch ist im Buchhandel erhältlich, auch als E-Book (nicht nur bei den hier verlinkten Händlern).
Und eine Rezension gibt’s auch (Wochenspiegel).
Über mich
Eva Andorn
Man soll ja keine Texte mit „Ich“ beginnen. (Mit „Man“ wahrscheinlich auch nicht.) Jetzt aber: Ich, die Autorin hinter dem Pseudonym Eva Andorn, wurde 1970 geboren und wuchs im schönen Ruhrgebiet auf. Ich bin ausgebildete Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, PR-Beraterin und Lektorin und habe lange in Bonn gelebt und noch länger in Berlin, wo ich unter anderem für verschiedene Redaktionen tätig war. Nach mehr als zwanzig Jahren in der Hauptstadt zog es mich aufs Land. Ich lebe mit meinem Mann, Hund und Hühnern in einem Dorf in der Prignitz/Brandenburg. Wenn ich nicht gerade selbst schreibe, arbeite ich als freie Lektorin.
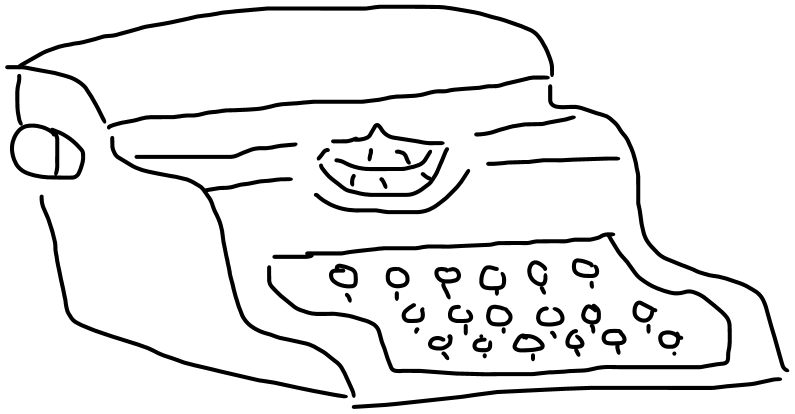
Kurze Geschichten (neue Texte, die nicht im Buch stehen)
Die Visitenkarte des Grauens
30. April 2024: Rückblick in den frühen Frühling
Erklär mir mal jemand, warum es Vorgärten gibt.
Wenn man das googelt, stößt man vor allem auf das Adjektiv „repräsentativ“, seltener auf so etwas wie „freundlich“ oder „einladend“.
Unser Vorgarten ist weder freundlich noch einladend, repräsentativ schon gar nicht. Was auch an uns liegt: Da wir diesen Streifen zwischen Straße und Haus nicht nutzen, vergessen wir ihn oft, zum Beispiel das Gießen von Kasten- und Kübelpflanzen, zum Beispiel das Beschneiden des Efeus, das recht malerisch Richtung Eingangstür und Wohnzimmerfenster wuchert.
Eine Einrichtungszeitschrift nennt den Vorgarten die Visitenkarte des Hauses. In unserem Fall stelle ich mir ein leicht fleckiges, schon eingerissenes und geknicktes Stück dünnen Kartons vor, auf dem dann wohl steht: „Hier leben unordentliche, schmuddelige, faule und unfähige Menschen. Willkommen!“
Ich beneide Christo nebenan, bei dem eine hohe Hecke, die angenehm wild und gar nicht spießig wirkt, das Grundstück begrenzt. Durch ein hölzernes Tor fällt man gleich in seinen verwunschenen Garten, ganz vorgartenlos.
Wir hingegen sind mit diesem Stück Land gesegnet, dass wir in keinster Weise brauchen. Selbst die zwei Meter bis zum Briefkasten müssen wir nur selten zurücklegen, da der Postbote meistens klingelt.
Also haben bloß die Nachbarn und Touristen was zu gucken. Mit einer soliden Hecke gäbe es zumindest einen Sichtschutz. Bei uns wurde ein Stück Buchenhecke gepflanzt, die leider nur ein Zehntel der Front vor Blicken schützt. Waren die Heckenbuchen dann ausverkauft? Wurde das Projekt vergessen?
Stattdessen mickern da verschiedene andere Sträucher vor sich hin, zwischen der obligatorischen Tuja und dem ebenso beliebten Ilex. Zum Beispiel ein Liebesperlenstrauch, Callicarpa bodinieri, der bei unserem Einzug mit unzähligen violetten Beeren ein richtiger Hingucker war, inzwischen nicht mehr. Allein die Forsythie gedeiht; ich bin froh, dass wir sie haben, zeigt sie doch mit ihren Blüten an, wann es Zeit für den Rosenschnitt ist.
Es fing schon schlecht an, nämlich mit dem Rhododendron am Zaun. Bei unserem Einzug hingen an dem alt wirkenden Gehölz noch drei braune Blätter, die ich gleich forsch abschnitt, einschließlich anscheinend toter Zweige. Danach las ich, dass man Rhododendren gar nicht beschneiden soll. Hatte ich ihn auf dem Gewissen oder war er ohnehin schon tot gewesen? Da sprießte gar nichts mehr. Schließlich wollte ich das Totholz ausgraben. Als ich aber die Schaufel ansetzte, kamen mir gleich sehr viele, wahrscheinlich wütende Ameisen entgegen. Bei näherer Betrachtung nutzten sie den Stumpf mittlerweile offenbar als Eingang zu ihrem Nest – so steht er nun also weiterhin herum, als Mahnmal und Ameisenbau-Entrée.
Anfangs kniete ich noch öfter vorn im Gras, ganz optimistisch. Beherzt riss ich aus Versehen schubkarrenweise Taubnesseln aus. Ich pflanzte allerlei im Beet an der Hauswand, was entweder gleich wieder einging oder vor sich hin kümmerte. Ich bepflanzte die Balkonkästen am Wohnzimmer- und Arbeitszimmerfenster mit Primeln, die zum Teil erfroren, zum Teil von Vögeln oder Wühlmäusen zerfressen wurden. Ich versuchte, den Kampf aufzunehmen mit Schöllkraut, Andorn und Löwenzahn, die sich gegen das Gras durchgesetzt hatten. Ich jätete Unkraut in den Fugen des gepflasterten Weges vom Tor zur Haustür. Ich grub, froh über meine Rosenhandschuhe, zahlreiche Robinientriebe aus, zumindest dieser Baum scheint gern bei uns zu wachsen, aber einer reicht.
Und immer, wenn ich da vorn etwas mache, höre ich Schulzens Gänse schräg gegenüber – schnatterschatter – und fühle mich leicht verspottet.
Ich versuchte es mit einer Rose, mit Katzenminze und Windenaussaat am Zaun zum Garten, doch ich stieß nach ein paar Zentimetern Graben zwar nicht auf Müll, jedoch auf ein altes Fundament, sodass dort einfach nichts anwachsen will.
Im frühen letzten Herbst kaufte ich Chrysanthemen, die teuer waren und nach einer regenreichen Woche einfach vermodderten. Etwa zur selben Zeit pflanzte ich zwei kleine, verblühte Hortensien neben den Rhododendronstumpf. Und siehe da, sie schienen sich wohlzufühlen: Während alle älteren Hortensien im Garten unseren ersten Sommer blütenfrei begleiteten, zeigten die kleinen Supermarktpflanzen bald neue Knospen. Kurz frohlockte ich, dann kam der Frost, und zurück blieben zwei matschige braune Haufen.
Aber es gab und gibt auch kleine Erfolge, die mich umso mehr freuen.
Im letzten Juni bemerkte ich, etwas spät, dass sich neben unserer Haustür ein beeindruckender Fingerhut erhoben hatte. Strenggenommen war das kein Erfolg, denn ich hatte nichts beigetragen. Egal, ich war begeistert, denn ich hatte gehört, dass der Fingerhut Jahre im Boden schlummern kann und nur hervorkommt, wenn die Lichtverhältnisse optimal sind. Eine tolle Pflanze! Nun bewachte also die hohe, weißblühende Digitalis unseren Eingang. Ob das ein freundliches, einladendes Zeichen an Besucher ist, ich weiß es nicht. Ein paar Wochen später gesellte sich ein weiterer Fingerhut dazu.
Was auch geht im Vorgarten: Zwiebelpflanzen. Der erste Frühling war eine wunderbare Überraschung mit all den Tulpen, Krokussen, Hyazinthen und winzigen Blausternen, die sich auf einmal zeigten. Die einzige Hyazinthe, die ich selbst gepflanzt hatte, wurde ganz schnell Opfer einer Wühlmaus.
Veilchen halten sich auch tapfer in den Kästen auf den Fensterbänken. Sie sind nicht so teuer wie die ohnehin zweifelhaften Chrysanthemen, dafür genügsam und ausdauernd.
Und dann sind da noch die Astern, die sich nach Marcs Affront mit dem Seitenschneider wieder aus dem Boden trauten, ergänzt um weitere Exemplare. Sie machen was her mit ihren blauvioletten Blüten – leider nur im Herbst.
Gerade schaue ich raus, vom Schreibtisch aus, was ich doch ganz gern mache. Auch wenn da draußen nichts passiert. Manchmal vielleicht gerade deshalb. Oschi streunt schnüffelnd am Zaun entlang, Blätter segeln im Wind. Aber wenn doch mal was Wichtiges oder Interessantes geschehen sollte – ich würde es nicht verpassen.
Schön sieht es da vorn, zwischen Fenster und Zaun, nach wie vor nicht aus, aber ich sage mir: Die Nachbarn kennen uns inzwischen, die wissen, dass wir nicht ganz so sind wie unser Vorgarten.
Alles in allem muss ich wohl einsehen: Licht und Boden sind nicht optimal. Zwischen den Pflanzen und der schönsten Sonne steht halt unser Haus. Machen wir das Beste draus. Vielleicht kommt die Taubnessel wieder. Gerade strecken die Tulpen ihre Blätter schon weit aus der Erde.
Ich schaue auf die Primeln, noch leuchten sie in Rot und Gelb, flankiert von weißen Stielprimeln und neuen Hyazinthen. Ich kann es doch nicht lassen. Schnatterschnatter.
Von Wanzen und vom Altwerden
15. Februar 2024
Wie ich merkte, dass ich doch mal wieder zum Augenarzt oder Optiker gehen sollte – ich muss etwas ausholen:
An die Kiefernwanzen, die sich hier im Haus, fast ausschließlich im Schlafzimmer, herumtreiben, habe ich mich gewöhnt. Ich möchte fast von friedlicher Koexistenz sprechen. Es gibt Ausnahmesituationen, zum Beispiel wenn es sich ein Tier in der Ohrmuschel meines Kopfhörers gemütlich macht.
Neulich wollte ich abends ganz leise sein. Ich hatte noch etwas im Bett gelesen, Marc atmete neben mir schon regelmäßig. Nur noch das Licht ausmachen. Doch da saß ein Vieh auf dem Kabel meiner Nachttischlampe, keine Kiefernwanze, aber sicher eine Wanze. Groß, platt, schwarzgrau, der Panzer voller winziger Knubbel, die aussahen wie Dornen. Ich schrie auf, ganz kurz nur, dann schnappte ich mir das Insekt mithilfe von Glas und Postkarte und warf es aus dem Fenster. Marc war wach und genervt. Ich beharrte darauf, ein fremdes und besonders ekliges Exemplar gefunden zu haben, mein Schrei war unbedingt berechtigt.
Am nächsten Tag ergab das Googeln, dass das wohl eine Stinkwanze gewesen war. Ich fühle mich gleich etwas wohler, wenn ich das, was da herumkraucht, wenigstens bestimmen kann.
Ich lege mich mittags gern eine Stunde hin, Lesen und Dösen. Als ich das Schlafzimmer betrat, sprang mich das ovale, schwarze Etwas geradezu an, also zum Glück nur im übertragenen Sinn, es saß auf dem Laminat, ich meinte, es hätte sich bewegt.
„Mann!“, rief ich, „hier ist so ein Ding, guck’s dir an! Ne Stinkwanze! Igitt!“
Marc kam zu mir herübergeschlendert und blickte mir über die Schulter.
„Wo denn?“, wollte er wissen, dabei war das doch eindeutig.
„Na da“, ich ging etwas in die Hocke, um mutig aus der Nähe auf die Wanze zu weisen.
Marc hockte sich ebenfalls hin, stand wieder auf und schüttelte milde lächelnd den Kopf.
„Das ist keine Wanze, das ist ein Sockenfussel. Du solltest wirklich dringend mal zum Augenarzt gehen!“
Off-Topic: Bei der Arbeit – Feedback
24. Januar 2024
Meine Mutter sitzt in ihrem Lesesessel und liest – mein Buch. Stumm, aber immerhin zügig.
Testleser einer frühen Vorversion hatten behauptet, beim Lesen durch lautes Lachen in der Regionalbahn aufgefallen zu sein. Meine Mutter liest völlig geräuschlos.
„Gefällt’s dir denn?“, frage ich dann doch.
„Ja natürlich gefällt es mir!“, sagt sie und klingt etwas angestrengt, aber das kann meine Interpretation sein. Ich warte, ob noch etwas kommt, nein, sie blättert um.
Feedback ist wichtig. Bei meiner Arbeit als Lektorin achte ich darauf, an dem, was andere geschrieben haben, – konstruktive – Kritik zu üben, die den Kunden im besten Falle weiterbringt und seinen Text besser macht.
Natürlich könnte ich am Seitenrand anmerken: „Dieses Kapitel ist strunzlangweilig.“ Stattdessen versuche ich das so zu umschreiben, dass derjenige, der das Kapitel verbrochen hat, nach Lesen meiner Kritik nicht denkt: „Ich kann’s halt nicht, ich geb’s auf“ oder: „Die Alte spinnt ja, ich suche mir eine neue Lektorin.“ Also schreibe ich eher etwas Erklärendes und mache Vorschläge, sodass der Kunde sich idealerweise angespornt fühlt, sein Werk zu überarbeiten. À la: „Das Kapitel würde ich etwas straffen, um das Handlungstempo hochzuhalten (s. letzte Kapitel). Zum Beispiel könnte dieser Satz m. E. raus: […] Die Figuren könnten noch lebendiger wirken, wenn […]“ So in der Art.
Zum ersten Mal habe ich nun selbst ein Buch geschrieben und merke, dass ich auch Feedback brauche. Was tut man da? Freunde, die sich interessiert zeigen und idealerweise von Berufs wegen selbst mit der Arbeit an Texten zu tun haben, sind perfekte Testleser. Sie wissen, wie man konstruktive Kritik übt und trauen sich das auch.
Andere Freunde hingegen sollte man besser verschonen, habe ich nun gelernt, auch wenn sie noch so freudig rufen: „Klar, schick mir dein Buch, lese ich super gern, bin doch neugierig!“
Manuskript mailen, zwei Wochen abwarten, vergewissern, dass die E-Mail-Adresse noch stimmte, die Mail angekommen war.
„Noch nicht dazu gekommen.“
Macht ja nichts. Zwei Monate warten, noch einen, Haken dran. Ich glaube, viele wagen es nicht, offen zu sagen, was ihnen nicht gefällt, auch weil nicht jeder weiß, wie man das motivierend hinbekommt, also so, dass man nachher immer noch befreundet ist. Es gibt natürlich noch andere mögliche Erklärungen, die mir alle im Laufe der Monate in den Sinn kamen: keine Lust, keine Zeit, vergessen, persönlicher Schicksalsschlag, was weiß ich. Ich bin etwas enttäuscht und ratlos (im wahrsten Sinne).
Nun regt sich meine Mutter doch, sie schaut mich an und sagt, offensichtlich auf Seite 150 angekommen, empört: „Dein Wellensittich ist nicht bei uns aus Kummer gestorben! Das stimmt nicht!“
Ein Feedback, na bitte, wenn auch überhaupt nicht konstruktiv.
Wenn die Silvester-Hits nicht helfen
8. Januar 2024
Unser Hund ist furchtlos. Dachten wir bisher. Er begegnet der Welt offen und neugierig, ob Mensch, Tier oder Pflanze. Ob Stein, Holzscheit, Kuhfladen, Autoreifen oder Winterstiefel. Die Welt will beschnüffelt werden, abgeleckt, markiert, bespielt, angeknabbert, zerlegt.
Selbst dem einen Dorfhund, der partout keine Lust hat, mit ihm zu spielen und der den Kleinen schon genervt zwickte, nähert sich Otto immer wieder, schwanzwedelnd und spielbereit. Furchtlos halt (und wenig lernfähig).
Lärm ängstigte Otto bisher auch nicht. Aus den Welpenwochen in Berlin kennt er alle Arten und Lautstärken von Großstadtlärm, das störte ihn nie, hinderte ihn noch nicht mal an einem Nickerchen.
Sein erstes Silvester, schon hier auf dem Land, verlief entsprechend unspektakulär. Die wenigen Böller, die ein paar Nachbarn verschossen, schien er zu ignorieren. Vielleicht auch, weil Nachbarhündin Bella es ihm vormachte.
Doch diesmal war alles anders am 31. Dezember. Ich verstand es bloß erst nicht. Nachmittags stieg Otto aufs Sofa, als wäre es selbstverständlich, und rollte sich neben mir ein. Auf meine Ansprache – „Runter! Aber schnell!!!“ – reagierte er gar nicht. Na gut, dachte ich, mach’s dir halt gemütlich, ausnahmsweise und solange Herrchen es nicht sieht.
Okay, in Sachen Konsequenz beim Thema Sofaverbot haben wir ein bisschen geschlampt. Immerhin weiß der Hund, eigentlich, dass er höchstens die Vorderbeine aufs Polster setzen darf und nur vorn, wo eine extra Decke liegt. Wenn er das tut, dann aus akutem Übermut und Kuscheldrang oder auch mal, um aus dem Fenster zu schauen, wenn er den Wagen des Postboten sieht.
Aber nun wollte er anscheinend nur neben mir liegen, dabei hechelte er, kam nicht zur Ruhe.
Später stellte ich ihm sein Futter hin – normalerweise kommt er schon angesprintet, wenn ich nur die Küchenwaage anfasse, diesmal aber: keine Reaktion. Ich setzte mich wieder zu ihm aufs Sofa, voller Sorge: War er krank? Magenverdrehung? Etwas anderes fiel mir in dem Moment nicht ein – Herumliegen, kein Appetit, Hecheln. Ich tastete seinen Bauch ab, der war aber weder aufgebläht noch hart.
In der Ferne ein Böller, Otto zuckte zusammen, zitterte, hechelte noch mehr. Da erst kam mir die Idee, dass er womöglich Angst vor dem Gekrache hatte.
Marc konnte ihn später zwar dazu bewegen, ein paar Schritte Richtung Küche zu machen, aber der Kleine stand dann nur mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren herum und tat uns sehr leid. Selbst sonst zuverlässige Wunderwaffen wie Hühnerfuß und Schweinohr interessierten ihn nicht. Den Rest des Abends wollte er nichts essen und auch nicht trinken.
Leider gab es diesmal kein Furchtlos-Vorbild für Otto. Wir würden ohne Christo und seine Bella ins neue Jahr starten, da unser Nachbar sich ein Virus eingefangen hatte.
Marc und ich saßen abends in der Küche und spielten ein neues Spiel, „Dorfromantik“, was sonst; der Hund verdrückte sich unter den Tisch, das hat er noch nie gemacht. Bei jedem entfernten Knallen zuckte er zusammen. Wir schalteten den Fernseher ein, die RBB-„Silvester-Hitparade“, extra für Otto, aber es schien ihm nicht zu helfen, weder laut noch leise. (Dafür krallte sich „Paloma Blanca“ als Ohrwurm in meinem Kopf fest, na danke).
Mitternacht, die Nachbarn legten sich leider mehr ins Zeug als beim letzten Jahreswechsel. Wir streichelten das Häufchen Elend unterm Tisch, bis es draußen endlich ruhiger wurde.
Am Neujahrsmorgen wankte ich schlaftrunken nach unten, zu früh, aber die Hühner nehmen ja keine Rücksicht auf Festivitäten.
Otto stand schon schwanzwedelnd unten an der Treppe, sein Blick schien mir zu sagen: Na endlich! Er fraß mit gutem Appetit und in Höchstgeschwindigkeit, leckte jeden Krümel auf, inspizierte seinen leeren Napf und die Fliesen, um anschließend interessiert am Küchenschrank zu schnuppern, auf dem das Schweineohr vom Vorabend lag. Kriegst du, Otto, hau rein.
Für den nächsten Jahreswechsel müssen wir uns was überlegen. Eierlikör? Baldrian? Bella? Häufigere Besuche in der lauten Großstadt zur Desensibilisierung? Silvestercamping mitten in einem Naturschutzgebiet, noch abgelegener als unser Dorf? Wir sind für alle Tipps offen!
Zu viel „süß“ ist auch zu viel
29. November 2023
Grundsätzlich finde ich Mäuse sehr niedlich mit ihren Knopfaugen, lustigen Nasen und Tasthaaren, mit ihren Pfötchen und großen Ohren. Im eigenen Haus brauche ich sie nicht.
Wir probierten es lange: Tolerieren und Nebeneinanderherleben. Auf dem Dachboden und in den Wandzwischenräumen störten sie nicht, wir hatten uns an das Getrappel ihrer winzigen Füße gewöhnt. Solange es nicht Hunderte wären und der Geruch verwesender Mäuseleichen durch Wände und Decken wehte. Was ich mir immer so vorstelle.
Die Nager übertragen Krankheiten, also würden wir langfristig etwas unternehmen müssen. Marc sprach davon, auf dem Dachboden nachzuschauen, um zumindest dort die undichten Stellen zu finden. Bevor ich da oben in Spinnenweben, zwischen lebendigen und toten Mäusen, Spinnen, Käfern und wer weiß, was noch, herumrobbe, würde ich jedes Geld für einen Kammerjäger ausgeben. Aber so weit waren wir noch nicht, dachte ich.
Nun scheint der Herbst Mäuse dazu zu bringen, sich nach einem behaglichen Plätzchen für die kalte Jahreszeit umzusehen – verständlich. Und da finden sie anscheinend unsere Wohnräume ganz prima, offensichtlich noch kuscheliger als Wände und Dachboden. Sie spazierten im September und Oktober zur Hintertür herein oder schlüpften durch geöffnete Fenster. Zunächst unbemerkt. Hörte ich es rascheln, dachte ich mir nichts dabei.
Marc erwischte eine Maus in der Küche und jagte sie raus, ich lachte. Der kleine Nager auf der Flucht vor dem großen Zweibeiner.
Am selben Tag hockte ich auf der Toilette und wieder raschelte es, ganz nah. Nanu? Da guckte mich auf einmal ein spitzes Gesichtchen an, die Maus hatte sich am Wäschekorb hochgezogen und schlüpfte nun hinein. Ich schrie auf vor Schreck, sehr laut wohl, Marc und Otto standen sogleich auf der Schwelle. Ich schämte mich – was für ein Klischee gab ich ab, es hätte noch gefehlt, dass ich auf den Badhocker gesprungen wäre. Ich zog schnell die Hose hoch, ließ die Männer ins Bad, winkte lachend ab und zeigte auf den Wäschekorb. Marc fischte die Maus heraus und setzte sie im Garten aus.
Einen Tag später saß ich in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und vernahm wieder lautes Geraschel. Schrapp, schrapp, schrapp, anscheinend lief das Tier an der Tapete hoch, schon lugte es über den Rand der Heizung. Ich stand auf, die Maus sprintete durch den Raum, aufs Gästebett und darunter. Gut, dass Otto in dem Moment nicht, wie so oft, sein Nickerchen bei mir hielt. Er hätte die Maus gejagt und dann zwar sicher nicht gefangen, aber mit seiner, sagen wir, wuchtigen Eleganz und seiner Körpermasse eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Er ist halt keine Katze.
Ich erinnerte mich an einen Urlaub als Kind auf einem Bauernhof mit Mäusen im Zimmer, die meine Eltern auf altmodische Art gefangen hatten. Also holte ich einen Putzeimer, zerbiss ein Stück Schokolade – Schoko-Nuss, da würde doch kein Nager widerstehen können – und warf es in den Eimer. Mithilfe eines breiten, langen Pinselstiels baute ich noch eine Art Rampe vom Boden zum Eimerrand.
Es dauerte keine fünf Minuten. Das Mäuschen saß in der Falle und konnte sich nicht entscheiden, abwechselnd nahm es die Schokolade zwischen die Pfötchen, um daran zu nagen, und sprang, so hoch es konnte, um sich zu befreien. Ich brachte das süße Ding ganz nach hinten an den Zaun, ab in die Freiheit (und komm nicht wieder).
Während ich ein bisschen stolz war auf meine altmodische, aber wirksame Art der Mäusevertreibung, kaufte Marc schnöde Holzfallen, die er im Flur und in der Küche aufstellte, jeweils außerhalb von Ottos Reichweite, der Schokolade auch nicht verschmäht.
Einen Tag später schon gab es den ersten Genickbruch. Hoffentlich war die Maus wenigstens sofort tot.
Aber die Tierchen scheinen lernfähig zu sein. Die nächste Falle war nämlich leer – keine Maus, keine Schokolade. Das angeknabberte Stück Schoko-Nuss fand ich Wochen später beim Putzen zwischen den Sofarückenkissen.
Eine Nachbarin empfahl uns garantiert sofort tödliche Plastikfallen mit dem irreführenden Namen „SuperCat“. Meines Erachtens eher das Gegenteil von Katzen – spielen die nicht erst mit ihrer Beute und legen sie dann als Geschenk auf Fußmatten oder in Betten?
Nun ist November, und der Plastiktod kommt bei uns zum Einsatz. In allen Räumen und in der Zwischendecke. Es wurde zu viel, so süß die Viecher auch anzusehen sind. Zum Beispiel hatten sie sich leider in unserer Küche das Pfannenschubfach als Rückzugsort ausgesucht. Das Fach ist zur Küchenrückwand offen, trotzdem frage ich mich, warum sie ausgerechnet die Gesellschaft von Pfannen suchen, wo es doch anderswo Lebensmittel gäbe. Ich zählte genau neunzehn Mäuseköttel im Fach. Ausräumen, Kot wegwischen mit Küchenrolle, Fach auswischen und schließlich etwas Essig verreiben. Lappen wegschmeißen.
Leider beschäftigte ich mich erst nach der Putzaktion eingehender mit Mäusen als Überträgern von Viren. Hantaviren werden genannt. Ich hätte zu Einweghandschuhen, Overall und Mundschutz greifen sollen, mindestens. Nach ein paar Wochen kann man Fieber bekommen und grippeartige Beschwerden, gefolgt von Magendarmproblemen. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen seit dem Schubladenputzen, noch fühle ich mich recht gesund. Bis auf dieses Kratzen im Hals …
Noch ein Grund mehr für die tödliche Plastikfalle. „Süß“ ist Geschichte.
Komm ruhig, Winter!
30. Oktober 2023
Gestern früh ging ich mit Otto Gassi, die Sonne schien, es waren um die fünf Grad und ich ärgerte mich, dass ich meine Handschuhe vergessen hatte. Dass an der Garderobe noch die Sommer- und Übergangsjacken hingen und sämtliche Winterklamotten noch im Sofa-Stauraum eingemottet waren. Der September war warm, doch die ersten Oktobertage warteten mit Regen und Sturm auf, nun ist die Kälte da. Immerhin habe ich die nicht winterharten Pflanzen schon in den Wintergarten gebracht.
Unterwegs trafen wir einen Nachbarn. Wir plauderten kurz über die Großbaustelle an der Landstraße und unseren Schleichweg ins nächste Dorf, durch den Wald. Der Nachbar warnte mich vor der Straße, ich solle lieber langsam fahren, der Zustand der Fahrbahn würde immer schlechter.
„Und der Winter kommt“, sagte er, mit einem durchaus bedrohlichen Unterton, „die meisten von uns werden ihn überleben, aber der eine oder andere wird da im Zaun hängenbleiben.“
Der Satz blieb haften. Der Winter kommt, die meisten von uns werden ihn überleben. Nicht alle. Ich bin gewarnt.
Später brachte eine Nachbarin Äpfel vorbei, ich war gerade bei der Gartenarbeit.
„Was du alles kannst und machst!“, rief sie, auch eine Zugezogene, bewundernd aus.
Ich rechte bloß etwas Laub zusammen, um rund um das vor ein paar Monaten gepflanzte Marillenbäumchen einen Schutz vor Frost aufzuschichten. Ich weiß noch nicht einmal, ob das notwendig ist, aber schaden wird es wohl nicht.
Ich hatte mittlerweile meine Winter-Gartenjacke entmottet und sah womöglich mit dem großen Rechen, der dicken, langen Jacke, Arbeitshose, Handschuhen und gefütterten Gummistiefeln recht professionell aus.
Die Gartenarbeit dauerte keine halbe Stunde. Ich ging wieder rein, setzte mich an den Schreibtisch und dachte zufrieden: Ich bin jetzt gebrieft und offensichtlich auch gut vorbereitet. Der Winter soll ruhig kommen.
Frage an die Natur: Schlafen Insekten?
18. Oktober 2023
Der Herbst, die Zeit des Übergangs, in mehrerlei Hinsicht.
Ist es im September oder Oktober warm und sonnig, scheint offenbar die Sonne in einem Winkel wärmend auf unseren Dachboden, dass sämtliche Fliegenarten noch mal Frühlingsgefühle bekommen. Im Schlafzimmer ein großes Gesumme und Gebrumme und schließlich Sterben, schwarze Fensterbänke. Ein Fliegenfänger an der Decke nutzt kaum etwas, da die Insekten fast ausschließlich gegen die Fenster fliegen. Ich nehme den Akkusauger. Anfangs hatte ich zum Saftglas gegriffen. Fliege mit dem Glas fangen, Postkarte drunterschieben, Fliege aus dem Fenster werfen. Wäre nun aber ein Halbtagsjob gewesen.
Neulich saß ich auf der Terrasse und wollte eine Kiefernwanze von meinem Stuhlkissen schütteln, in dem Moment fiel eine andere in mein Glas. Hatte ich die zwei bei der Balz gestört? Die ersten in diesem Herbst. Aha, geht los, dachte ich, es war auch auf einmal merklich kühler geworden. Der Wechsel von Fliege zu Wanze stand an. Ich wollte morgens oben zur Toilette gehen, hob den Klodeckel, und auf der Brille saß eine Wanze. Ich schlug gestern die kuschelige Überdecke hoch, zwischen Bettdecke und Fleece lag, na, was wohl. Sah gemütlich aus. Glas, Postkarte, aus dem Fenster damit. Die Wanzen treten nicht so invasiv auf wie die Fliegen, außerdem widersetzen sie sich dem Sauger tapfer. Und irgendwie mag ich sie. Kurzer Gedanke: Hatte die geschlafen? Hab ich die aufgeweckt? Anschlussfrage: Schlafen Insekten? Ich habe keine Ahnung. Bei Eintagsfliegen zum Beispiel wäre Schlafen ja ganz schön verschwendete Lebenszeit. Aber womöglich haben die auch ein anderes Zeitempfinden.
Ja, Insekten schlafen. Ich finde eine Studie zum Schlafverhalten der Bienen. Sie haben wohl unterschiedliche Schlafphasen und man merkt ihnen an, wenn sie unausgeschlafen sind. Je nach Alter und Funktion wird unterschiedlich lange, zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten geruht.
Alle Insekten schlafen, sagt ein Insektenforscher. Unterschiedlich viel, je nachdem wie viel sie sonst in Bewegung sind. Sie brauchen die Ruhepausen. Man könne es ihnen ansehen, wenn sie schlafen, sie sitzen dann ganz ruhig da, um aufzutanken.
Upps, arme Wanze. Unsensibel aufgeweckt und dann noch aus dem Fenster geschmissen. Ich hätte noch mehr Fragen: Träumen Insekten? Und wie lange brauchen Insekten, um wach zu werden? Bei mir dauert das schon mal etwas länger. Für die Wanze hoffe ich: nicht länger als der Transport vom Bett zum Fenster, zumindest um die Erinnerung zu aktivieren, dass sie fliegen kann.
Kontaktieren Sie mich gern:
andorn@evaandorn.de